 |
Loginoder neu registrieren? |
|||||
              
| ||||||
SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert
|  Kriminalisierung des christlichen Menschenbildes?7. Dezember 2019 in Schweiz, 12 Lesermeinungen Der Sonderschutz der sogenannten Rassismus-Strafnorm soll künftig nebst Gruppen einer bestimmten Rasse, Ethnie oder Religion auch für sexuelle Minderheiten gelten. Ein Weckruf an die Schweizer Bischöfe. Von Dominik Lusser, Stiftung Zukunft CH. Engelberg (kath.net) Mehr gabs, mit löblicher Ausnahme des Churer Weihbischofs Marian Eleganti, von den Mitgliedern der Schweizer Bischofskonferenz nicht zu vernehmen. Erstaunlich, denn die erweiterte Norm droht in gravierender Weise mit Grundrechten wie der Religions- und Gewissensfreiheit zu kollidieren, worüber in der Schweiz seit Monaten aufgeregt diskutiert wird. Die scheinbare Ignoranz der Bischöfe wirft Fragen auf. Nach einem gewichtigen Teil der Lehre ist das von Artikel 261bis StGB geschützte Rechtsgut die Menschenwürde. Doch gerade darin sehen namhafte Juristen ein Problem. Wie der Basler Strafrechtsprofessor Mark Pieth in seinem Strafrechtskommentar schreibt, stellt Art. 261bis ein Lehrstück dafür dar, wie Strafrechtgesetzgebung nicht betrieben werden sollte, da der Text schwere Mängel aufweise. So sei z.B. das Tatbestandsmerkmal der Menschenwürde nach dem Bestimmtheitsgebot im Strafrecht nicht nur zu unpräzise, sondern auch unnötig und kontraproduktiv, da der Schutz der Menschenwürde sowieso Zweck jeder Strafrechtsbestimmung sei. Definition wirkt ausgrenzend Das Bundesgericht seinerseits hielt in einem Urteil von 2017 fest: Bei der Menschenwürde handelt es sich ( ) um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der durch Gesetzgeber und Gerichte zu konkretisieren ist. Der Verfassungsgeber habe nicht nur deswegen von einer Definition abgesehen, um der Prinzipienhaftigkeit und Entwicklungsoffenheit des Grundrechts Rechnung zu tragen, sondern auch, weil eine verfassungsrechtliche Bestimmung dessen, was die Würde und den Wert eines Menschen ausmache, grundsätzlich problematisch wäre. Wird mit einer Festlegung der Menschenwürde ein bestimmtes Menschenbild für achtens- und schützenswert erklärt, so besteht die Gefahr, dass dadurch Menschen in ihrer Würde beeinträchtigt werden, die den Wert des Menschseins anders verstehen. Dies könne man, so das Bundesgericht, als Paradox der Menschenwürdegarantie bezeichnen: Je klarer ihre Konturen sind und je besser demnach Achtung und Schutz gelingen, desto grösser ist das Risiko der Ein- und Ausgrenzung von Menschen. Was den Inhalt der Menschenwürde ausmache, müsse in einer liberalen Gesellschaft daher letztlich offenbleiben. Bezogen auf Art. 261bis stellt sich demnach die Frage, welches Menschenbild der Richter zugrunde legen soll, wenn er zu beurteilen hat, ob eine Diskriminierung oder Herabsetzung im konkreten Fall in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise (Absatz 4) erfolgt. Wie auch Rechtsexperten, die der Rassismus-Strafnorm wohlgesonnen gegenüberstehen, einräumen müssen, ist es immer auch eine Frage gesellschaftlicher Sensibilitäten und politischer Machtstrukturen, in welchen Fällen die Menschenwürde als verletzt angesehen wird und in welchen nicht. So die Juristin Vera Leimgruber in einer Publikation der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Mitentscheidend, ob eine Diskriminierung oder herabsetzende Äusserung als Angriff auf die Menschenwürde gewertet wird, ist laut einschlägigen Kommentaren der Eindruck, der beim unbefangenen, durchschnittlichen Dritten entsteht. Konkret heisst das: Geschützt wird das Menschenbild des gesellschaftlichen Mainstreams, während Minderheitsansichten übergangen werden. Dies zu verhindern war jedoch gerade der Grund, warum der Verfassungsgeber auf eine Definition der Menschenwürde verzichtet hat. Person und Handlung Unzweifelhaft ist, dass die mindere Bewertung der Hautfarbe eines Menschen direkt auf den Wesenskern (Marcel A. Niggli) der Persönlichkeit zielt, da die Hautfarbe angeboren, und daher von der Person nicht zu trennen ist. Es ist rassistischen Ideologien eigen, in einer bestimmten Hautfarbe die Manifestation eines minderwertigen Menschentyps zu sehen. Das neue Kriterium der sexuellen Orientierung die nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht angeboren ist und überdies fluide sein kann mit der Hautfarbe zu vergleichen, erscheint hingegen abwegig. Dennoch ist es der LGBT-Bewegung gelungen, die sexuelle Vorliebe für das gleiche Geschlecht im gesellschaftlichen und politischen Diskurs als Identität zu etablieren. Im gegenwärtigen Klima, das sexuelle Splittergruppen als Lieblinge des Zeitgeists (Katharina Fontana) verehrt, ist folglich damit zu rechnen, dass Kritik an der sexuellen Orientierung bzw. an entsprechendem Verhalten vor Gericht ähnlich bewertet würde wie Kritik an einer bestimmten Hautfarbe, nämlich als Herabsetzung der Menschenwürde. Zwischen der Würde einer Person einerseits und ihrem Verhalten, ihrer Lebensweise und ihren Meinungen anderseits zu unterscheiden, ist ein Kerngehalt des christlichen Menschenbildes. Darauf gründet letztlich auch die Bürgertugend der Toleranz. Die erweiterte Rassismus-Strafnorm birgt allerdings die Gefahr, diese Unterscheidung zu unterlaufen. Gemäss einem mir vorliegenden Rechtsgutachten der Zürcher Rechtsprofessorin Isabelle Häner dürfte künftig z.B. die öffentlich getätigte Aussage, homosexuelles Verhalten sei heterosexuellem Verhalten moralisch unterlegen, den objektiven Tatbestand von Artikel 261bis erfüllen. Nach Häners Auffassung ist es ferner unwahrscheinlich, dass ein Richter einen Unterschied machen würde zwischen der Meinungsäusserung: Homosexuelles Verhalten ist menschenunwürdig, und der Aussage: Homosexuelle sind keine Menschen. Dies ist brandgefährlich, weil damit differenzierte Menschenbilder, die zwischen Person und Handlung von (homosexuellen) Menschen unterscheiden, um deren Menschenwürde zu wahren, pauschal als menschenverachtend kriminalisiert werden. Wie unrecht man damit Bürgern tun kann, die mit Hass und Hetze nichts am Hut haben, zeigt ein Interview des Sittener Bischofs Jean-Mary Lovey mit Le Nouvelliste vom August 2015, das schon damals für viel Empörung sorgte. Der Kirchenmann vertrat darin die Ansicht, dass Homosexualität geheilt werden kann. Auf Rückfrage, ob er Homosexualität also als Krankheit ansehe, meinte er: Nein, es ist eine Schwäche der Natur, die sich darin zeigt, dass betroffene Personen und ihr Umfeld real leiden. Doch dadurch wird dem Menschsein der homosexuellen Person und ihrer Würde nichts genommen. Ungeachtet dieser meines Erachtens menschenfreundlichen Differenzierung: Auch Bischof Lovey müsste Häner zufolge künftig unter Umständen mit einer Verurteilung rechnen, vorausgesetzt, dass ihm Vorsätzlichkeit nachgewiesen werden kann. Und das Gewissen? Mit Blick auf Absatz 5 der Strafnorm, die Leistungsverweigerungen unter Strafe stellt, ist ferner mit empfindlichen Beschneidungen der Gewissensfreiheit zu rechnen. Eine Organisation für Adoptionsvermittlung, die ihre Dienstleistungen nur heterosexuellen Paaren anbieten will, weil sie die Ansicht vertritt, dass Kinder idealerweise einen Vater und eine Mutter brauchen, müsste laut Häners Gutachten ebenso mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen wie ein Bischof, der einem Theologen eine Anstellung deswegen verwehrt, weil er in einer eingetragenen Partnerschaft lebt ein identischer Fall hat sich 2017 im Bistum Basel ereignet. Und auch der Konditor, der aus Gewissensgründen keine Torte für eine gleichgeschlechtliche Hochzeitsfeier backen möchte, könnte ins Visier der Strafverfolgung geraten. Häner geht davon aus, dass die Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe aus Gewissensgründen nicht als sachlicher Grund für eine Leistungsverweigerung gelten dürfte. Dies, zumal ansonsten Artikel 261bis Abs. 5 StGB mit Berufung auf das Gewissen vollständig ausgehebelt werden könnte. Das Gewissen galt einst als die rationale Entscheidungsmitte der Person, und die Freiheit, danach zu handeln, als Inbegriff einer humanen, aufgeklärten Gesellschaft. Die vom Parlament geforderte Erweiterung des Rassismus-Strafnorm stellt diesen Begriff der Menschenwürde auf den Kopf, indem sie das sexuelle Begehren zum Kern der Persönlichkeit erklärt. Darüber hinaus kriminalisiert sie das Handeln nach einem Gewissen, das bestimmte sexuelle Ausdrucksformen moralisch kritisch bewertet. Wenn das kein Angriff auf die Menschenwürde ist? Dass die Schweizer Bischöfe zu dieser drohenden Kriminalisierung des christlichen Menschenbildes nicht mehr zu sagen haben, ist nicht nur unverständlich, sondern höchst besorgniserregend. Der Autor leitet den Fachbereich Werte und Gesellschaft bei der Stiftung Zukunft CH: www.zukunft-ch.ch Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuSchweizer Bischofsko
| 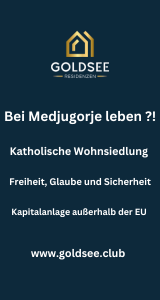      Top-15meist-gelesen
| |||
 | ||||||
© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||
